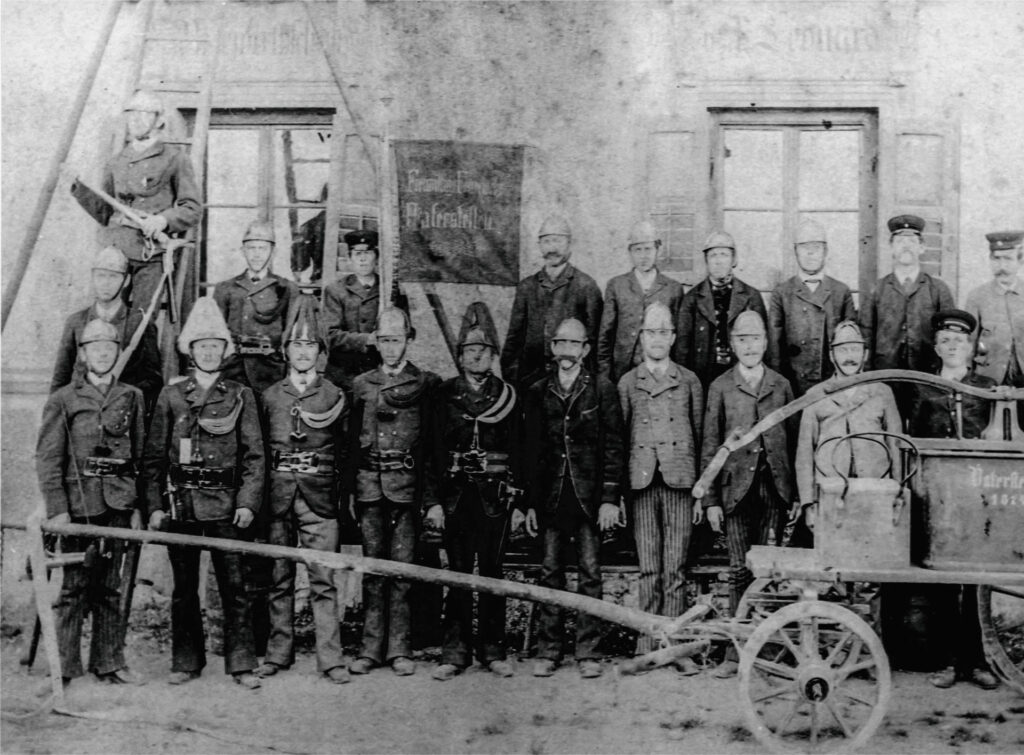Im Jahr 1874 gegründet, blickt die Freiwillige Feuerwehr Vaterstetten mittlerweile auf eine über 150-jährige Geschichte zurück.
Geschichte
Chronik
Auf den folgenden Seiten lassen wir die lange Geschichte der Vaterstettener Floriansjünger Revue passieren. Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums wurde die Chronik 2024 umfassend ergänzt, fortgeschrieben und mit zahlreichen historischen Fotos bebildert.
Kommandanten
der Feuerwehr Vaterstetten von 1874 bis heute:

Josef Böhm
1874 – 1905

Michael Plötz
1905 – 1913

Balthasar Reitsberger
1913 – 1942

Josef Hartl
1942 – 1946

Michael Plötz
1946 – 1948

Leo Schnitzlbaumer
1948 – 1950

Johann Luft
1950 – 1979

Josef Winner
1979 – 1990

Herbert Fietz
1990 – 1998

Gerhard Fischbach
1998 – 2005

Erwin Reimer
2005 – 2012

Wolfgang Deutschmann
2012 – 2018

Julian Kuhn
2018 – 2024

Michael Fietz
seit 2024
Vorstände
der Freiwillige Feuerwehr Vaterstetten. In den Jahren von 1969 bis 1984 gab es keinen Vorstand, da die Eintragung in das Vereinsregister erst am 9. März 1984 erfolgte.
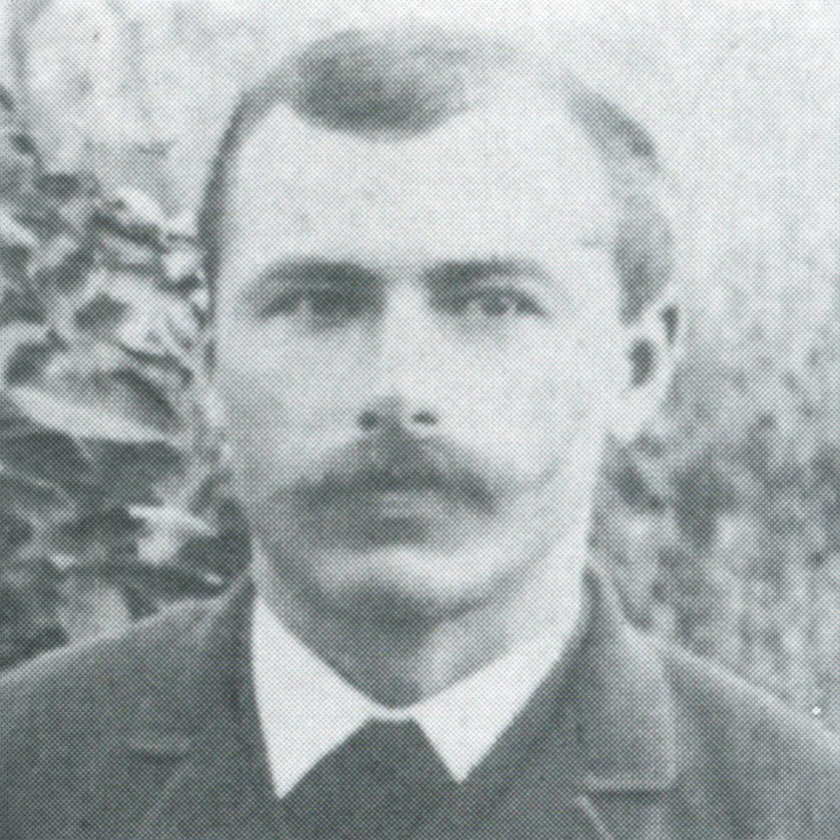
Michael Plötz
1933

Georg Ach
1950 – 1969

Wilhelm Holubek
1984 – 1990

Alfred Böhm
1990 – 2022

Josef Schmied
seit 2022